
Mangroven und Korallenriffe stehen vor dem Kollaps
n-tv
Der Klimawandel lässt die Weltmeere immer weiter anschwellen. Das bedroht wiederum zahlreiche Lebensräume an den Küsten. Sollte die Erderwärmung nicht gestoppt werden, werde es bald keine Mangrovenwälder und Korallenriffe mehr geben, warnt nun ein Forschungsteam und verweist auf die letzte Eiszeit.
Wenn es nicht gelingt, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens einzuhalten, könnten viele Küstenökosysteme wie Mangrovenwälder, Korallenriffe und Seegraswiesen untergehen. Davor warnt ein internationales Forschungsteam im Fachblatt "Nature". Die Autoren berufen sich bei ihrer Prognose auf Erkenntnisse aus der letzten Eiszeit: Damals bedeutete der Anstieg des Meeresspiegels zu deren Ende hin das Aus für weite Teile der Lebensräume an den Küsten.
Vor 17.000 Jahren konnte man trockenen Fußes von Deutschland nach England, von Russland nach Amerika und vom australischen Festland nach Tasmanien spazieren. Möglich war dies, da der Meeresspiegel etwa 120 Meter niedriger lag als heute. Mit dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren schwollen die Ozeane rapide an, im Durchschnitt stieg das Wasser um einen Meter pro Jahrhundert. Dieser Anstieg zerstörte viele Küstenlebensräume - ihre Erholung dauerte Tausende Jahre. Ebendieses Szenario könnte sich der Studie des Teams unter australischer Leitung zufolge wiederholen, wenn die globalen Durchschnittstemperaturen über ein bestimmtes Niveau steigen.
Hauptautor Neil Saintilan von der Macquarie University in Sydney macht in einer Mitteilung zur Studie deutlich, was Küstenökosysteme meint: Diese "gibt es dort, wo unsere Ozeane auf das Land treffen, darunter Mangroven, Küstensümpfe und die Ränder sandiger Koralleninseln - die tiefliegenden Regionen, die vom Salzwasser der Gezeiten überflutet und entwässert werden".

Disorazol Z1 ist ein Naturstoff, der normalerweise von Bakterien produziert wird. Er kann das Wachstum von Zellen verhindern und diese auch zerstören. Daher wird er bereits seit Längerem als mögliches Antikrebsmittel untersucht. Jetzt konnten Magdeburger Chemiker erstmals den Wirkstoff im Labor nachbauen.





















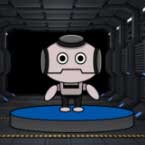 Run 3 Space | Play Space Running Game
Run 3 Space | Play Space Running Game Traffic Jam 3D | Online Racing Game
Traffic Jam 3D | Online Racing Game Duck Hunt | Play Old Classic Game
Duck Hunt | Play Old Classic Game









