
Infektionswelle baut sich auf - was ist zu tun?
n-tv
Von 100 Menschen in Deutschland waren vergangene Woche fast 9 krank. Ein vergleichsweise hoher Stand ist zu Beginn des Herbstes nicht ungewöhnlich. Doch kommen zur typischen Erkältung auch wieder vermehrt Corona-Infektionen. Anlass genug für Experten, an Impfempfehlungen und Hygiene-Regeln zu erinnern.
Überall in Deutschland wird derzeit gehustet, geschnieft oder geschnäuzt. Die Virenmenge in Deutschland ist nicht nur gefühlt sehr groß, sondern auch statistisch belegt auf hohem Niveau. Tendenz steigend. Nach einer Erhebung des Robert-Koch-Instituts (RKI) gab es in der letzten kompletten Oktoberwoche 8500 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner. Das ist für diese Kalenderwoche der höchste Wert seit Beginn der Datenreihe im Jahr 2011. Allerdings schwanken die Zahlen im Herbst und Winter meist stark. Ursache für den hohen Wert sind laut RKI neben den für die Jahreszeit typischen Erkältungen auch die seit Anfang Juli "kontinuierlich steigende Zahl" von Corona-Infektionen.
Die Atemwegserkrankungen führten laut RKI in der Oktoberwoche zu 1,4 Millionen Arztbesuchen (1700 pro 100.000 Einwohner). Diese Zahl ist für Ende Oktober eine der höchsten in den vergangenen Jahren. In den Proben von Atemwegspatienten, die von Ärzten zu Laboren geschickt wurden, fanden sich vor allem Corona- und Erkältungserreger.
Eine Prognose für die weitere Saison ist laut RKI nicht möglich. Das hänge unter anderem davon ab, ob und wann weitere Erreger wie das Atemwegsvirus RSV oder Grippeviren dazu kommen und ob die bisher zirkulierenden Viren dann bleiben oder eher abgelöst werden. "Die ersten kalten Wochen im Herbst sorgen erfahrungsgemäß immer für einen deutlichen Anstieg der Infekt-Fälle in unseren Praxen", sagte Markus Beier, Bundesvorsitzender des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes. Diesmal scheine es aber besonders viele Atemwegsinfektionen zu geben, darunter seien Covid-19-Fälle, aber auch "klassische" Erkältungskrankheiten.

Disorazol Z1 ist ein Naturstoff, der normalerweise von Bakterien produziert wird. Er kann das Wachstum von Zellen verhindern und diese auch zerstören. Daher wird er bereits seit Längerem als mögliches Antikrebsmittel untersucht. Jetzt konnten Magdeburger Chemiker erstmals den Wirkstoff im Labor nachbauen.





















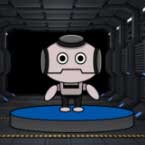 Run 3 Space | Play Space Running Game
Run 3 Space | Play Space Running Game Traffic Jam 3D | Online Racing Game
Traffic Jam 3D | Online Racing Game Duck Hunt | Play Old Classic Game
Duck Hunt | Play Old Classic Game








