
Eine 100 Milliarden Euro schwere Erleichterung für Kanzler Merz
n-tv
Die Klage gegen den Solidaritätszuschlag scheitert. Weder hat das Bundesverfassungsgericht ein Problem mit den weiter bestehenden Kosten der Wiedervereinigung noch mit der einseitigen Belastung von Spitzenverdienern. Schwarz-Rot kann aufatmen, die FDP erntet die nächste Klatsche.
Das Bundesverfassungsgericht ist immer für eine Überraschung gut. Die Beteiligten der Ampelkoalition können davon ein Lied singen. Erst kassierte Karlsruhe den Gesetzgebungsprozess zum Heizungsgesetz wegen nicht eingehaltener Beratungsfristen, dann erklärten die Richter die Finanzierung des Klima- und Transformationsfonds über die Umwidmung von Corona-Krediten für unzulässig. Das Urteil gilt als Anfang vom Ende der Regierung Olaf Scholz. Entsprechend bange schauten an diesem Mittwoch die sich zur nächsten Regierungsbildung anschickenden Parteien CDU, CSU und SPD von Berlin aus in den Südwesten. Dort wurde final befunden, dass die fortgesetzte Erhebung des Solidaritätszuschlags für Spitzenverdiener und Unternehmen rechtmäßig ist.
Andernfalls hätte die kommende Regierung nicht nur schlagartig rund 12 Milliarden Euro weniger Einnahmen pro Jahr gehabt. Sie hätte womöglich auch 60 Milliarden Euro an die verbliebenen Soli-Zahler zurückerstatten müssen. 100 Milliarden Euro weniger für die kommenden vier Jahre: Die Koalitionsbildung wäre erheblich schwieriger geworden. Es ist bekannt, dass die Bundesverfassungsrichter meist auch einen Blick für die praktischen Folgen ihrer Urteile haben - und wissen, dass Deutschland schnell eine funktionierende Regierung braucht. Das geschlossene Votum des Zweiten Senats mit nur einer abweichenden Begründung ist aber ein starkes Zeichen - und eine Klatsche für die Kläger aus den Reihen der FDP.





















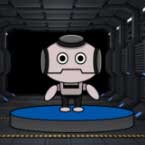 Run 3 Space | Play Space Running Game
Run 3 Space | Play Space Running Game Traffic Jam 3D | Online Racing Game
Traffic Jam 3D | Online Racing Game Duck Hunt | Play Old Classic Game
Duck Hunt | Play Old Classic Game











