
Wie Stottern im Gehirn entsteht
n-tv
Menschen, die Stottern, haben es oftmals schwer. Die Ursachen für die Sprechstörungen sind vielfältig. Forschende finden nun im Gehirn ein bestimmtes Netzwerk, das damit im Zusammenhang steht. Die aktuellen Erkenntnisse könnten zu neuen, wirkungsvollen Therapieformen führen.
Stottern kann verschiedene Ursachen haben - unabhängig davon geht es einer Studie zufolge aber auf ein bestimmtes Netzwerk im Gehirn zurück. Die Lokalisierung eröffne neue Möglichkeiten für die medizinische Behandlung, hofft das Forschungsteam. Womöglich könne zum Beispiel eine Hirnstimulation speziell auf das Netzwerk ausgerichtet werden.
Stotterer sind nicht schlechter darin, beim Sprechen die passenden Wörter zu finden. Beeinträchtigt ist die Fähigkeit, die beabsichtigten Worte adäquat auszusprechen. Die Störung des Sprachrhythmus ist durch unwillkürliche Laut- und Silbenwiederholungen, Verlängerungen und Sprechblockaden gekennzeichnet, wie es in der im Fachjournal "Brain" vorgestellten Studie heißt.
Ungefähr fünf bis zehn Prozent der Kleinkinder stottern demnach, geschätzt ein Prozent - überwiegend Männer - stottert bis ins Erwachsenenalter weiter, fast immer lebenslang. Stottern tritt über alle Kulturen hinweg ähnlich oft und familiär gehäuft auf. In Deutschland stottern nach Schätzungen etwa 800.000 Menschen dauerhaft.

Ein brennendes Metallstück, entdeckt mitten in der Wüste: In Westaustralien ist ein großes Trümmerteil aus dem Himmel gefallen. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass es von einer chinesischen Jielong-Rakete stammt. Weltraumexperten warnen: Solche Abstürze könnten in Zukunft häufiger vorkommen.

Ultra-Ausdauersportler vollbringen physische Höchstleistungen, doch auch ihre Energie hat eine biologische Grenze. Forschende stellen jetzt fest, dass der Kalorienverbrauch der Sportler langfristig das 2,5-Fache des Grundumsatzes nicht überschreitet. Die Ergebnisse werfen ein neues Licht auf die Belastbarkeit des menschlichen Körpers.

Mal eben bei Tiktok oder Instagram hereingeschaut und hängengeblieben - schon wieder ist eine halbe Stunde Lebenszeit weg. Aber was hab ich da gerade eigentlich gesehen? Oft belangloses Zeug, von dem wenig hängenbleibt. Folgen hat das Dauerscrollen in sozialen Medien dennoch - für den Einzelnen, aber auch für Gesellschaften und die Zukunft dieser Welt.





















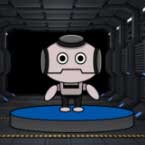 Run 3 Space | Play Space Running Game
Run 3 Space | Play Space Running Game Traffic Jam 3D | Online Racing Game
Traffic Jam 3D | Online Racing Game Duck Hunt | Play Old Classic Game
Duck Hunt | Play Old Classic Game








