
Was hilft gegen Doomscrolling?
n-tv
Wenn negative Nachrichten auf die Funktionsweise sozialer Medien treffen, dann gibt es dafür einen Begriff: Doomscrolling. Der Dauerkonsum kann nicht nur belasten, sondern im Extremfall zu psychischen Erkrankungen führen. Doch es gibt Wege, dem entgegenzuwirken.
Die schlechten Nachrichten nehmen kein Ende, so scheint es in diesen Zeiten. Mehr als zwei Jahre Corona-Pandemie liegen hinter uns, in denen das unsichtbare Virus vormals unbekannte Ängste ausgelöst hat. Und dann der Krieg. Seit über zwei Monaten tobt er, mitten in Europa. Ein mit dem Eisernen Vorhang begraben gedachtes Atomkriegs-Szenario ist plötzlich wieder im Bereich des Möglichen und damit in unseren Köpfen. Wir sehen vom heimischen Bildschirm aus, wie nur einige Flugstunden von Deutschland entfernt grausamste Massaker an der ukrainischen Zivilbevölkerung verübt werden. Das, es lässt sich nicht von der Hand weisen, macht was mit einem.
Das Marktforschungsinstitut Rheingold drückt das in einer tiefenpsychologischen Untersuchung wie folgt aus: "Die Krisenpermanenz, die vor allem junge Menschen als eine nicht enden wollende Dauerkrise erleben, hat eine neue Dimension bekommen, die auch die bisherigen Sorgen um Corona weitgehend überdeckt: Wir geraten von einer Katastrophe in die nächste schlimmere."
Durch die ständigen Hiobsbotschaften macht sich bei vielen Menschen ein Gefühl der Hilflosigkeit breit. Weil Handlungsmöglichkeiten fehlen, ist die Reaktion häufig: Dauerhafte Informationsbeschaffung, um stets "up to date" zu sein und zugleich auf die gute Nachricht, die Erlösung hoffen. Wenn die allerdings ausbleibt, wie es bei komplexen Themen naturgemäß oft der Fall ist, kann das dazu führen, dass Menschen sich den negativen Themen förmlich hingeben. "Unser Gehirn hat eine Aufgabe: Uns am Leben zu halten", erklärt Maren Urner im Gespräch mit ntv.de. "Es ist optimiert, auf negative Nachrichten schneller, besser und intensiver zu reagieren als auf positive und neutrale Nachrichten", so die Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie.

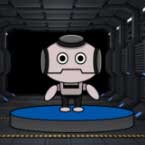 Run 3 Space | Play Space Running Game
Run 3 Space | Play Space Running Game Traffic Jam 3D | Online Racing Game
Traffic Jam 3D | Online Racing Game Duck Hunt | Play Old Classic Game
Duck Hunt | Play Old Classic Game