
Mini-AKW? "Keiner weiß, ob es funktioniert"
n-tv
Die EU will neue Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als umweltfreundlich einstufen. Die Bundesregierung spricht von Greenwashing, wird den Beschluss aber vermutlich nicht verhindern können. Denn im Angesicht der Klimakrise erlebt die Technologie eine Renaissance. Der neue CDU-Chef Friedrich Merz flirtet öffentlich genauso damit wie der frühere italienische Innenminister Matteo Salvini. In Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron sogar schon eine neue Kernkraft-Ära angekündigt, in den USA sind bereits 18 Projekte in Planung. Sie setzen auf die sogenannte SMR-Technologie, Small Modular Reactors. Denn sie verspricht kleine, günstige und vielfältig einsetzbare Reaktoren, die CO2-arm, aber zuverlässig Energie produzieren. So wie in Russland, wo ein schwimmendes AKW bereits ein Dorf in Sibirien versorgt.
Gar keine schlechte Idee, oder? Findet Christoph Pistner nicht, wie das Mitglied der Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) im ntv-Podcast "Klima-Labor" deutlich macht. Der Physiker des Freiburger Öko-Instituts hat die SMR-Technologie für das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) untersucht und keine überzeugenden Argumente entdeckt, im Gegenteil: Die bisherigen SMR-Ideen sind ihm zufolge genauso schmutzig wie konventionelle Atomkraftwerke, teurer sogar als erneuerbare Energien und vor allem sind sie vermutlich erst dann einsatzbereit, wenn es schon zu spät ist.
ntv.de: Was wissen Sie über die SMR-Technologie, was der amerikanische, der französische und der russische Präsident nicht wissen?

2023 reißen sich die Bieter um deutsche Offshore-Flächen. Zwei Jahre später ist die Windkraft-Euphorie verpufft. Bei einer Versteigerung im Juni bieten nur zwei Interessenten für eine neue Nordsee-Fläche. TotalEnergies sichert sich den Zuschlag für einen Spottpreis. Laut Karina Würtz belasten steigende Stahlpreise und das China-Risiko die Branche. Und der Solarboom: "Wenn die Strompreise sinken, rechnet sich der Bau nicht mehr", sagt die Geschäftsführerin der Stiftung Offshore-Windenergie. Die Prognose der früheren Windpark-Leiterin beunruhigt: Ohne Kursänderung wird Deutschland sein Ausbauziel für die Erneuerbaren verfehlen. Im "Klima-Labor" von ntv präsentiert Würtz eine Lösung für das Problem. Die Offshore-Branche benötige ein neues Vergütungsmodell. Verluste müssten vergemeinschaftet werden, die Gewinne ausnahmsweise auch.

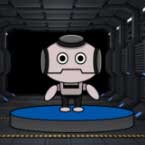 Run 3 Space | Play Space Running Game
Run 3 Space | Play Space Running Game Traffic Jam 3D | Online Racing Game
Traffic Jam 3D | Online Racing Game Duck Hunt | Play Old Classic Game
Duck Hunt | Play Old Classic Game










