
"Hubble" findet Stern in atemberaubender Ferne
n-tv
Das Weltraumteleskop "Hubble" sorgt kurz vor seinem Ende für eine spektakuläre Entdeckung: Ein Stern in der Rekorddistanz von 12,9 Milliarden Lichtjahren ist der mit Abstand entfernteste bekannte. Ein besonderes Phänomen macht die Entdeckung überhaupt erst möglich.
Während sein Nachfolger - das "James Webb Space Telescope" - schon erste Bilder liefert, sorgt das 32 Jahre alte Weltraumteleskop "Hubble" noch einmal für Schlagzeilen: Es hat einen Stern entdeckt, dessen Licht 12,9 Milliarden Jahre zur Erde unterwegs ist. Das ist ein neuer Rekord und ein gewaltiger Sprung vorwärts: Der bisherige Rekordhalter war lediglich vier Milliarden Lichtjahre entfernt. Der neue Rekord-Stern besaß vermutlich mehr als die 50-fache Masse unserer Sonne und ist bereits nach wenigen Hunderttausend Jahren verglüht, wie das Entdeckerteam im Fachblatt "Nature" berichtet.
"Earendel" haben die Astronomen um Brian Welch von der Johns Hopkins University in Baltimore den Stern getauft - nach einem altenglischen Wort für den Morgenstern. Aufspüren konnten die Forscher "Earendel" durch kosmische Unterstützung: Zwischen der Erde und dem fernen Stern liegt ein gewaltiger Galaxienhaufen, der als Gravitationslinse das Licht des Sterns um mehr als das Tausendfache verstärkt.
Welch und seine Kollegen vergleichen die Wirkung des Galaxienhaufens mit der Wasseroberfläche eines Swimming Pools: Die Wellen brechen das einfallende Sonnenlicht und erzeugen ein Muster heller Linien auf dem Grund des Pools. Die Wissenschaftler nennen solche Linien Kaustiken - es sind Bereiche, in denen das Licht extrem verstärkt wird. Die Schwerkraft des Galaxienhaufens lenkt das Licht von hinter dem Haufen liegenden Himmelsobjekten ähnlich wie die Wasseroberfläche ab und erzeugt so ebenfalls Kaustiken - die durch ihre Verstärkung weit entfernte Sterne sichtbar machen können.

Peter Schreiner, Professor für Organische Chemie an der Universität Gießen, ist es mit seinem internationalen Team erstmals gelungen, ein Molekül aus sechs Stickstoffatomen herzustellen, auch Hexastickstoff oder N6 genannt. Es handelt sich dabei um die energiereichste Substanz, die jemals gebildet wurde. Bei sehr niedrigen Temperaturen von minus 196 Grad wurde im Labor ein dünner Film in Reinform hergestellt. Die dazugehörige Studie erschien in der renommierten Fachzeitschrift "Nature".

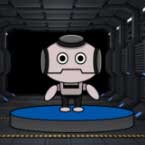 Run 3 Space | Play Space Running Game
Run 3 Space | Play Space Running Game Traffic Jam 3D | Online Racing Game
Traffic Jam 3D | Online Racing Game Duck Hunt | Play Old Classic Game
Duck Hunt | Play Old Classic Game



