
"Fängt nicht beim Schießen an": Forscher zu Polizeigewalt
n-tv
Nicht immer werden Polizisten als Freunde und Helfer empfunden. Eskalation bei Einsätzen und Vorwürfe überzogener Gewalt lösen immer wieder Kontroversen aus. Manche Situationen ergeben ein besonderes Konfliktpotenzial, so ein Polizeiforscher.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wenn Polizisten Gewalt ausüben, kann das als letztes Mittel mit einem Einsatz zusammenhängen. Doch es gibt auch immer wieder Vorwürfe nach Vorfällen, bei denen der Einsatz von Gewalt überzogen oder gar unprovoziert erscheint. Im August vergangenen Jahres etwa löste der Fall eines 16-Jährigen eine große öffentliche Debatte aus, nachdem der Jugendliche in Dortmund von Polizeibeamten mit einer Maschinenpistole bei einem Einsatz erschossen worden war.
Hat die Polizei ein Gewaltproblem? Und wie ist Gewalt überhaupt zu definieren? Einigen dieser Fragen ist der Polizeiforscher Tobias Singelnstein in seinem neuen Buch nachgegangen. Der Jurist, der an der Frankfurter Goethe Universität lehrt und forscht, sprach dazu mit Betroffenen von Polizeigewalt ebenso wie mit Polizisten, Führungskräften der Polizei und internen Ermittlern, die sich mit der Aufklärung von Gewaltvorwürfen in den eigenen Reihen befassen.
"Die Gewalt fängt nicht erst beim Schießen an, sondern eigentlich schon bei einfachen Überwältigungshandlungen", sagte Singelnstein der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse sich klar machen: "Für Leute, die von diesem Gewalteinsatz betroffen sind, ist es immer eine relativ drastische Erfahrung - auch wenn jemand nur mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht wird und auch wenn das rechtmäßig erfolgt."





















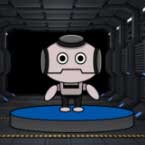 Run 3 Space | Play Space Running Game
Run 3 Space | Play Space Running Game Traffic Jam 3D | Online Racing Game
Traffic Jam 3D | Online Racing Game Duck Hunt | Play Old Classic Game
Duck Hunt | Play Old Classic Game











