
Der verheißungsvolle Nicht-Ort
Frankfurter Rundschau
Angela Merkel perfektionierte den pragmatisch operierenden Regierungsstil. Das utopische Denken haben wir in dieser Ära verlernt. Doch Kunst und Poesie können uns Wege zeigen, wie wir es wiedererlangen.
Man stelle sich einmal vor, überall dort, wo uns ansonsten grauer Beton anstarrt, würden Textzitate, Aphorismen oder einfach inspirierende Malereien zu sehen sein. Spazierengehen käme so ganz by the way einem überraschenden Bildungsvergnügen gleich. Was für manche reichlich absurd klingen dürfte, ist allerdings kein neumodischer Einfall aus der Graffiti-Szene, sondern wurde bereits 1602 von dem Mönch Tomaso de Campanella in seiner futuristischen Konzeption „Die Sonnenstadt“ entworfen. Er wollte Wissen unter das breite Volk bringen und schuf nicht mehr und nicht weniger als eine Utopie – ein Begriff, der von Thomas Morus über Gustav Landauer bis hin zu Karl Mannheim oder Ruth Levitas eine lange Geschichte nach sich zog.
Erst vor dem Hintergrund des gescheiterten Wettbewerbs zwischen Faschismus und Sozialismus im 20. Jahrhundert verlor er seine Strahlkraft. Statt den verheißungsvollen Nicht-Ort zu denken, beschränkte sich die Politik infolge des Zusammenbruchs des Eisernen Vorhangs auf das Prinzip Reform. Der Merkelismus wurde zur Perfektion eines reaktiven, pragmatisch operierenden Regierungsstils.
Und nun? Schon im vergangenen Wahlkampf wurde deutlich, dass uns der Klimawandel und geopolitische Herausforderungen zu tiefgreifenden Veränderungen zwingen. Das Drehen an Stellschrauben, hier eine Steuer senken, dort ein wenig härtere Regeln durchsetzen – all diese kleinen Korrekturen werden den allzu komplexen Anforderungen der Spätmoderne nicht gerecht. Kurzum: Es bedarf eines neuen, utopischen Geistes, mithin des Mutes zum Experiment. Genau darin besteht etwa für Ernst Bloch, den großen Vordenker der Utopie, die Aufgabe der Hoffnung. Sie „ist das Gegenteil (…) eines naiven Optimismus“ und darf nicht mit bloßem Dahinträumen verwechselt werden. Schenkt man ihm Glauben, so zündet der utopische Funken nicht durch ein Schauen in die Glaskugel, sondern geht manchmal sogar in die Vergangenheit zurück. Er spricht vom „Unabgegoltenen“, das „gärt“, also von visionären Gedanken, die noch nicht realisiert wurden. Man denke etwa an frühe schon von Walt Disney oder Frank Lloyd Wright entwickelte, aber in der Schublade verbliebene Stadtutopien.

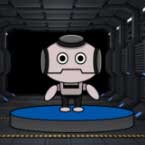 Run 3 Space | Play Space Running Game
Run 3 Space | Play Space Running Game
 Traffic Jam 3D | Online Racing Game
Traffic Jam 3D | Online Racing Game
 Duck Hunt | Play Old Classic Game
Duck Hunt | Play Old Classic Game